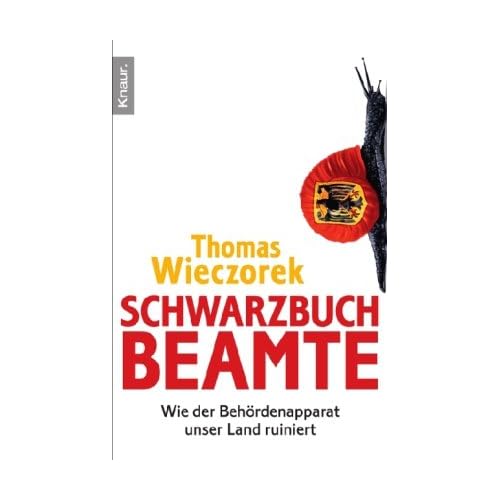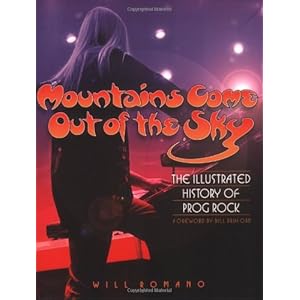Die Wahrheit ist nicht genug
Daniel Domscheit-Berg hat mit Julian Assange "Wikileaks" berühmt gemacht. Er glaubte, sie seien Freunde. Jetzt weiß er, dass sie Feinde wurden. Die Geschichte einer Enttäuschung. Von Marie Katharina Wagner
FRANKFURT, 23. Februar
Es soll einen Film über Julian Assange geben, in dem er nach einem Auftritt in der amerikanischen Talkshow "Larry King" sein Gesicht auf einer Reihe von Titelseiten sieht. Überall Assange, Assange, Assange. Er sagt dann, mehr wohl zu sich selbst: "Jetzt bin ich unantastbar in diesem Land." So beschreibt Daniel Domscheit-Berg diese Szene zumindest in seinem Buch. Er schreibt darin auch: "Nein, Julian. Niemand ist unantastbar."
Daniel Domscheit-Berg ist der ehemalige Sprecher der Enthüllungsseite "Wikileaks". Lange war er der Gegenpol zu Assange. Domscheit-Berg war der Vernünftige, Assange der Exzentriker: So sieht es Domscheit-Berg. In seinem Buch "Inside Wikileaks - meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt" schreibt er über die Arbeit mit dem Australier. Es ist eine Liebeserklärung an Assange - und auch eine Abrechnung.
Domscheit-Berg, der einmal so viel Hoffnung in "Wikileaks" setzte, dass er sich das Logo der Website auf den Rücken tätowieren ließ, hat getan, was in der Szene als Hochverrat gilt. Er hat seine Enttäuschung über den Gründer von "Wikileaks" in die Öffentlichkeit getragen. Sogar Auszüge aus internen Chats hat er publik gemacht. Sie sollen das unberechenbare Sozialverhalten des Australiers beweisen. Domscheit-Berg schreibt, er habe einst geglaubt, Julian Assange sei sein bester Freund. Jetzt sind sie Feinde.
Wie es sich für ein Enthüllungsbuch über eine Enthüllungsseite gehört, wurden pünktlich zur Veröffentlichung Einzelheiten des Rosenkriegs "geleakt", der zwischen Assange, dem zur Kultfigur gewordenen ehemaligen Hacker, und Domscheit-Berg, dem unauffälligen, stets in Schwarz gekleideten Informatiker, schon seit längerem schwelt und der zunächst in der Suspendierung des Deutschen durch Assange im August 2010 gipfelte. Auf der Enthüllungsseite "Cryptome.org" tauchten Auszüge aus Domscheit-Bergs Buch auf, in denen er beschreibt, wie er bei seinem Weggang von "Wikileaks" Daten und auch Software mitgenommen habe. Als Grund gab er an, die Daten seien bei "Wikileaks" nicht mehr sicher gewesen. Assange schaltete umgehend einen Anwalt ein und ließ Domscheit-Berg über einen Sprecher ausrichten, er sei ein Saboteur, der nie sonderlich großen Einfluss bei "Wikileaks" gehabt habe. Domscheit-Berg wiederum bezeichnet Assange in seinem Buch als "paranoid", "machtversessen" und "größenwahnsinnig". Er schwärmt aber auch von ihm, er habe "noch nie so eine krasse Persönlichkeit erlebt": "So freigeistig. So energisch. So genial." "Wikileaks" sagt er eine düstere Zukunft voraus: Eigentlich sei das Projekt gar nicht mehr existent. Assange habe längst alle fähigen Leute verprellt.
Bei dem, was nach außen wirkt wie der Hahnenkampf zweier beleidigter Schuljungen, geht es um mehr: Es geht um zwei Menschen, deren Vorstellungen von politischem "Hacktivism" und dem gezielten Geheimnisverrat sich irgendwann drastisch auseinanderentwickelt haben.
Im Jahr 1996, zehn Jahre bevor "Wikileaks" im Netz erscheint, gründet der Amerikaner John Young mit "Cryptome.org" eine der ersten großen Enthüllungsseiten. Dort veröffentlicht er Dokumente und Fotos, die von Regierungen als geheim eingestuft werden. Julian Assange ist damals ein junger Hacker, 25 Jahre alt, und er verfolgt "Cryptome.org" mit Begeisterung. Er gehört zu dieser Zeit zu den "Cypherpunks", einer Bewegung, deren Leitmotiv die Kryptographie ist, die Verschlüsselung privater Daten, und die andererseits dafür kämpft, geheime Daten öffentlich zu machen. Dem Staat begegnet sie mit Misstrauen, das an Paranoia grenzt.
Schon in seiner frühen Jugend ist Assange politisch aktiv, er kämpft gegen Scientology und wettert gegen globale Konzerne, Amerika und das Versagen der Massenmedien, die in seinen Augen ihrer Kontrollfunktion nicht gerecht werden. Mit Aktivistenfreunden, deren Internetseiten er betreut, lebt er in einem großen alten Haus in Melbourne. Sie sind "Hacktivists", politische Hacker, deren goldene Regel es ist, Informationen öffentlich zu machen, sie mit anderen zu teilen. Sie brechen nicht, wie unpolitische Hacker, heimlich in Netzwerke ein, bloß um sich selbst zu beweisen, dass sie auch die größten Sicherheitshürden überwinden können. Sie wollen etwas bewirken - mehr Transparenz schaffen.
In einem Porträt von Assange, das in der Zeitschrift "New Yorker" erschien, schreibt Raffi Khatchadourian über dessen politische Motivation: "Er verstand den Kampf des Menschen nicht als Kampf zwischen links und rechts oder zwischen Glaube und Vernunft, sondern als Kampf zwischen Individuum und Institution." Das "Leaken" sei für ihn ein Mittel gewesen, Regierungshandeln, das er für illegitim hielt, zu sabotieren. Illegitim wird es für ihn in dem Moment, da es zur Herrschaftssicherung die Verschwörung braucht. Indem er die interne Kommunikation der "Verschwörer" unterbricht und öffentlich macht, glaubt er, das verschwörerische Element vernichten zu können.
2006 entscheidet sich Assange, den gezielten Geheimnisverrat zu seiner Lebensaufgabe zu machen. Er stellt sich dabei nicht als Aktivisten, sondern als Journalisten dar, der für einen "wissenschaftlicheren" Journalismus sorgen will, indem er unbearbeitete Quellen zugänglich macht. Er bezeichnet sich als "Chefredakteur" und "Wikileaks" als "Medienorganisation" - aber widerspricht dem auch wieder, wenn er gegenüber dem "New Yorker" sagt, seine Mission sei nicht die ausgewogene Darstellung von Ereignissen, sondern das Aufzeigen von Ungerechtigkeiten.
Autoren Marcel Rosenbach und Holger Stark zitieren in ihrem Buch "Staatsfeind Wikileaks" aus internen E-Mails an freiwillige Mitarbeiter, die für eine Verortung im linken Spektrum plädiert hatten. Assange schreibt da: "Ihr müsst eure eigene Agenda als Progressive / Kommies / Sozialisten und die entsprechende Rhetorik für euch behalten, oder es wird euch sehr, sehr schnell ins Aus führen."
Genauso wie die wenigsten Hacker politische Aktivisten sind, ist längst nicht jeder "Leak" politisch motiviert. Auch Videospiele und Filme werden "geleakt", also vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin ins Internet gebracht. "Leaken" sei dank Assange "Popkultur" geworden, sagt der Gründer des Blogs "Netzpolitik.org", Markus Beckedahl. "Bei der jungen Internetgeneration ist es angekommen", sagt er, "dass man einmal in seinem Leben etwas leaken sollte." Der Begriff ist in den deutschen Wortschatz übergegangen, die Berliner "Tageszeitung" handelte ihn 2010 als Anwärter für den "Anglizismus des Jahres". Unzählige Seiten im Internet künden von der Banalisierung des Phänomens, die meisten sind unprofessionell und kaum der Rede wert. Das Angebot reicht von studentischen Projekten wie "Bayernleaks", das potentielle Quellen auf eine E-Mail-Adresse verweist mit dem Hinweis, momentan sei "nur unverschlüsselter Kontakt möglich", bis hin zu Gerüchten, in China wollten Dissidenten demnächst eine Website mit dem Namen "Government Leaks" gründen. "Brusselsleaks" will Informationen über interne Strukturen der EU sammeln, "Balkanleaks" kämpft gegen Korruption und organisierte Kriminalität in Osteuropa, und das amerikanische "localeaks" ist auf Kommunalpolitik spezialisiert. Keine der "Wikileaks"-Trittbrettseiten, die er kenne, sei wirklich sicher für anonyme Einsender, sagt Markus Beckedahl.
Auch Domscheit-Berg hat ein eigenes Projekt angekündigt: "Openleaks", das im Frühjahr starten soll. Mit ihm will der Informatiker all das verwirklichen, was bei "Wikileaks", so stellt er es dar, an Assanges Allmachtsanspruch scheiterte. Nun will Domscheit-Berg seine Ideen, die nicht so weit gehen wie die von Assange, endlich umsetzen: "Openleaks" soll selbst keine Dokumente veröffentlichen, sondern nur als Vermittler zwischen Quelle und Medium dienen. Der anonyme Absender kann selbst entscheiden, wer seine Papiere bekommt, das "Openleaks"-Logo soll wie ein virtueller Briefkasten auf den Internetseiten von beteiligten Nichtregierungsorganisationen und Medien stehen. Finanzieren soll sich das Projekt wie "Wikileaks" hauptsächlich über Spenden, aber anders als dort sollen auch die Partnermedien einen monatlichen Beitrag zahlen.
"Openleaks" entsteht vor einem anderen Hintergrund als "Wikileaks": Domscheit-Berg war vor seiner Zeit bei "Wikileaks" kein politischer Hacker. Er trägt seine Einstellung noch weniger vor sich her als Assange, bezeichnet aber das Werk "Was ist das Eigentum?" des französischen Ökonomen und Anarchisten Pierre-Joseph Proudhon als das "bedeutendste Buch, das je geschrieben wurde". Bevor er Assange kennenlernte, beriet er als IT-Sicherheitsexperte in Rüsselsheim große Firmen und sagt heute, seinem Leben habe damals der "Sinn gefehlt". Begeistert stieß er 2007 zu "Wikileaks" und gab zwei Jahre später seinen Job als Programmierer auf.
Sein Idealismus wurde bald enttäuscht - weil Assange in seinem eigenen Projekt die Hacker-Regel vom Teilen aller Informationen nicht befolgte. Auch wenn Domscheit-Berg einer seiner wichtigsten Mitarbeiter war und über lange Zeit als einziger neben ihm öffentlich auftrat, erfuhr er erst nach seinem Ausscheiden von Strukturen innerhalb der Organisation, von denen er über die Jahre nichts gewusst hatte. "Wikileaks" habe lange Zeit eine Art Scheinexistenz geführt, beschreibt er in seinem Buch - Assange und er seien unter mehreren Tarnnamen aufgetreten, um eine größere Organisation mit mehr Mitarbeitern vorzutäuschen. Auch die Dokumente seien nicht von Hunderten Freiwilligen, sondern fast alle von Assange und ihm auf ihre Echtheit untersucht worden. Jetzt soll Transparenz das Leitmotiv für "Openleaks" sein.
Er wolle mit "Openleaks" keine Politik machen, sondern sie nur ermöglichen, sagt Domscheit-Berg immer wieder. Sein Modell soll neutraler sein als das von Assange, der irgendwann angefangen habe, Material zu bearbeiten, und damit die Ursprungsidee verriet. "Openleaks" werde die "Verantwortung auf viele Schultern verteilen", indem es die Entscheidung, wie man mit dem Material umgehe, den Quellen und Medien überlasse. Bei Wikileaks hätte letztlich vor allem Assange diese Entscheidungen getroffen.
Wie erfolgreich "Openleaks" werden wird, ist schwer abzusehen. Große Medien wie "Al Dschazira" und die "New York Times" sollen längst an eigenen Kanälen für anonyme Geheimnisverräter bauen. Für kleinere Medien und Organisationen könne "Openleaks" aber zu einer wichtigen Informationsquelle werden, sagt Markus Beckedahl. Allerdings nur, wenn Domscheit-Berg seine Reputation in der Szene durch sein Buch nicht zu sehr beschädigt habe. In den Augen vieler Hacker bediene dies doch allzu sehr den Boulevard.
Assange erscheint darin als jemand, dem es immer schwerer fiel, die Macht mit anderen zu teilen. Zuletzt habe ihn sogar die Sicherheit der Quellen nicht mehr sonderlich interessiert - während er sich um die eigene Sicherheit immer mehr gesorgt habe. Hinter den Vergewaltigungsvorwürfen, die zwei Schwedinnen gegen ihn erhoben haben, wittert Assange eine internationale Verschwörung. An diesem Donnerstag könnte in England die Entscheidung über seine Auslieferung nach Schweden fallen. Julian Assange weiß längst, dass er nicht unantastbar ist.
Text: F.A.Z., 24.02.2011, Nr. 46 / Seite 3